Emmanuel
Macron (EM/–), der am vergangenen Sonntag zum Präsidenten des
zweitgrößten EU-Mitgliedstaats gewählt wurde, dürfte für viele
seiner Kollegen im Europäischen Rat gleichzeitig ein
Hoffnungsschimmer und eine Zumutung sein. Auf der einen Seite führte
er einen Wahlkampf, von dem viele Politiker träumen: Trotz knapper
Umfragewerte vor der ersten Wahlrunde verzichtete er auf Appelle
an die niederen Instinkte und setzte stattdessen auf Zivilität und
Weltoffenheit. Ausgerechnet gegen die prominenteste Repräsentantin
der europäischen nationalistischen Rechten, Marine Le Pen (FN/BENF), bekannte er sich demonstrativ zur EU, schwenkte
blaue Fähnchen, ließ
die „Ode an die Freude“ spielen, sprach
sogar Englisch – und war mit alledem so erfolgreich, wie sich
das all die zaghaften Mitte-Politiker, die die europäische
Integration eigentlich für eine gute Sache halten, aber glauben,
dass man den Wählern nicht zu viel davon zumuten dürfe, niemals
hätten vorstellen können.
Auf
der anderen Seite ließ Macron aber auch wenig Zweifel daran, dass er
mit der Europäischen Union in ihrer heutigen Form nicht zufrieden
ist. In seinem Wahlprogramm
kritisierte er ein „verlorenes Jahrzehnt“ und stellte eine ganze
Reihe von Reformforderungen auf – von einem Europäischen Konvent
zur Vertragsreform über transnationale
Listen bei der Europawahl bis zu einer europäischen
Grenzschutzagentur, einer intensiveren gemeinsamen
Verteidigungspolitik, einem gemeinsamen Haushalt und einer
parlamentarischen Versammlung für die Eurozone sowie einem
europäischen Mindestlohn. Auf einer Veranstaltung gegen Ende des
Wahlkampfs warnte
er davor, dass die EU ohne solch weitreichende Reformen
dysfunktional bleiben würde, was den Rechten in die Hände spiele
und letztlich zu einem EU-Austritt Frankreichs führen könne.
Forderung
nach politischem Mut
Nun
sind Macrons Forderungen bei genauerer Betrachtung gar nicht
besonders originell. Im Gegenteil: Die meisten seiner Vorschläge
werden auf europäischer Ebene bereits seit längerer Zeit diskutiert
und sowohl unter Experten als auch in den EU-Institutionen selbst als
sinnvoll erachtet. Die Reformideen zur Währungsunion finden sich
beispielsweise fast alle schon im „Vier-Präsidenten-Bericht“ von
2012 (PDF)
oder in den Memoranden
verschiedener nationaler Regierungen von 2015. Sie wurden nur
niemals umgesetzt, weil sich nach der Eurokrise die Konjunktur etwas
erholte und angesichts des Aufstiegs rechter Parteien allzu
weitreichende Reformen politisch nicht opportun wirkten.
Wenn
Macron diese Vorschläge nun wieder aufgreift, verlangt er seinen
Kollegen denselben politischen Mut ab, den auch er mit seinem
proeuropäischen Bekenntnis im Wahlkampf gezeigt hat. Damit aber
dürfte er sich unter den anderen Regierungschefs nicht nur Freunde
machen. Die Gipfelstürmer-Haltung des neuen französischen
Präsidenten verträgt sich schlecht mit der Durchwurstelei, die der
Europäische Rat in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat.
Keine
etablierte Partei im Rücken
Zum
Fremdeln zwischen Macron und den übrigen Regierungschefs dürfte
auch beitragen, dass der neue französische Präsident keine der
etablierten Parteien hinter sich hat. Nach einer Karriere als
Investmentbanker war er ab 2012 Wirtschaftsberater, dann von 2014 bis
2016 Wirtschaftsminister unter dem sozialistischen Präsidenten
François Hollande (PS/SPE). Es wäre also sicher zu viel behauptet,
ihn als politischen Außenseiter zu bezeichnen.
Parteimitglied
im PS war Macron allerdings nur kurzzeitig von 2006 bis 2009, und
während seiner Amtszeit als Minister lag er vor allem mit dem linken
Flügel der Partei im Dauerstreit. Dass er 2016 schließlich die
Bewegung „En Marche!“ gründete (deren Anfangsbuchstaben den
Initialen seines eigenen Namens entsprachen) und wenig später aus der
Regierung ausschied, bezeichnete er selbst als eine
„Entscheidung, um frei und verantwortlich sein zu können“.
Einige Sozialisten sprachen hingegen von einem „Verrat“
an seiner früheren Partei. Und auch dass Macron nicht an den
Vorwahlen des linken Lagers teilnahm, sondern als unabhängiger
Kandidat antrat, stieß
im PS auf scharfe Kritik.
Freiheit
zum eigenen Programm
Tatsächlich
dürfte die eigene Parteigründung für Macron ein zweischneidiges
Schwert gewesen sein. Auf der einen Seite stellte der Verzicht auf
die Unterstützung durch etablierte Parteistrukturen im Wahlkampf ein
ernsthaftes Risiko dar. Bis heute ist offen, ob es En Marche gelingen
wird, bei
der Parlamentswahl im Juni eine Mehrheit zu gewinnen.
Auf
der anderen Seite erlaubte die Unabhängigkeit von etablierten
Parteien Macron aber auch, sein Programm weitgehend selbst zu
definieren. Er entledigte sich damit nicht nur der parteiinternen
Streitigkeiten zwischen dem linken und dem wirtschaftsliberalen
Flügel der französischen Sozialisten, die die Regierung unter
François Hollande in den letzten Jahren gelähmt hatten. Vor allem
musste Macron auch bei der Auswahl der Themen, mit denen er Wahlkampf
führen wollte, keine Kompromisse machen – und konnte sich deshalb
ganz darauf konzentrieren, der weltoffene Gegenspieler von Marine Le
Pens rechtsnationalistischem Front National (FN/BENF) zu werden.
Der
neue Gegensatz von Kosmopoliten und Nationalisten
In
der Politikwissenschaft wird bereits seit einigen Jahren eine
Neuausrichtung der Gegensätze im politischen System beobachtet:
Traditionell ließ sich das Spektrum der politischen Positionen recht
gut erklären, indem man zum einen zwischen wirtschaftspolitisch
linken und rechten, zum anderen zwischen gesellschaftspolitisch
liberalen und autoritären Parteien unterschied. Mit den zunehmenden
grenzüberschreitenden Verflechtungen – sowohl durch die
europäische Integration als auch durch die Globalisierung im
weiteren Sinne – wurden diese Gegensätze jedoch durch eine dritte
Dimension ergänzt und überlagert: Ein großer Teil der politischen
Debatten kreist inzwischen vor allem um die Frage, wie offen oder
geschlossen ein Land nach außen sein sollte.
In
diesem Konflikt zwischen Kosmopoliten und Nationalisten besetzen
Parteien wie der französische FN konsequent den Geschlossen-Pol.
Dadurch können sie einen recht kohärenten Diskurs anbieten, in
dessen Zentrum die Rückgewinnung nationaler Souveränität und der
Kampf gegen ausländische Einflüsse steht – etwa die Ablehnung von
Zuwanderern oder die Kritik an der scheinbaren „Fremdbestimmung“
durch die EU und andere überstaatliche Organisationen.
Etablierte
Parteien schwanken bei der Positionierung
Für
viele etablierte Parteien der Mitte stellt der neue Gegensatz
zwischen Souveränisten und Kosmopoliten hingegen eine große
Herausforderung dar. Da sie sich bislang eher über die
traditionellen Links-rechts- bzw. Liberal-autoritär-Dimensionen
definiert hatten, haben ihre Mitglieder und Wähler in der Frage der
offenen oder geschlossenen Grenzen oft geteilte Ansichten. Dies führt
zu internen Spannungen und hindert die Parteien daran, sich klar zu
positionieren.
Besonders
deutlich ist dies bei Sozialdemokraten und Linken zu beobachten, die
zwischen Internationalismus und nationaler Sozialstaatlichkeit
schwanken. Aber auch in christdemokratischen und vielen liberalen
Parteien gibt es interne Spannungen, wenn das Bekenntnis zu
universellen Werten mit der Sorge um eine nationale „Leitkultur“
oder der Wunsch nach großen transnationalen Märkten mit der
Ablehnung grenzüberschreitender finanzieller Solidarität in
Konflikt geraten.
Am
nächsten am kosmopolitischen Pol befanden sich im traditionellen
Parteiensystem noch die Grünen, die deshalb auch
von den Nationalisten meist als Hauptgegner gesehen werden. Doch
auch diese schrecken immer wieder vor einem eindeutigen Bekenntnis
zurück: So forderte etwa der grüne Spitzenkandidat für die
deutsche Bundestagswahl, Cem Özdemir (Grüne/EGP), jüngst eine
restriktivere
Handhabung der doppelten Staatsbürgerschaft – und zeigte sich
damit in dieser Frage „geschlossener“ als die christdemokratische
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU/EVP).
Macron
besetzte den kosmopolitischen Pol
In
Frankreich nun konnte sich Emmanuel Macron als unabhängiger Kandidat
von diesen Uneindeutigkeiten lösen und in seinem Wahlkampf gezielt
den kosmopolitischen Pol besetzen – was ihm klarere Antworten
erlaubte und ihn dynamischer erscheinen ließ als viele seiner
Gegenkandidaten. Natürlich hatte er daneben auch Glück, dass sich
sein aussichtsreichster Konkurrent François Fillon (LR/EVP) durch
eine Reihe von Skandalen selbst beschädigte.
Letztlich
aber zeigte sich ein ähnliches Bild wie schon bei der
Präsidentschaftswahl
in Österreich Ende 2016: In einem Wahlkampf, der sich immer mehr
auf den Gegensatz zwischen Souveränismus und Weltoffenheit
zuspitzte, schieden die Kandidaten der etablierten Mitte-links- und
Mitte-rechts-Parteien in der ersten Runde aus – und in der
Stichwahl unterlag der Kandidat der nationalistischen Partei gegen
den unabhängigen Kosmopoliten.
Europäische
Reaktionen
Macrons
Wahlsieg erschüttert
deshalb nicht nur das französische Parteiensystem, sondern muss
auch den Mitte-Politikern in anderen Ländern zu denken geben, die
dem Aufstieg der Nationalpopulisten bislang eher ausweichend begegnet
sind. Tatsächlich sind schon jetzt in verschiedenen anderen Parteien
Versuche erkennbar, an Macrons Erfolg teilzuhaben: Die liberale
Europapartei ALDE etwa versucht
offenbar, En Marche zu einem Beitritt zu bewegen. Die grünen
Politiker Sven Giegold und Franziska Brantner initiierten einen
Aufruf,
in dem sie Schnittstellen zwischen ihren und Macrons Zielen
hervorhoben. Und Martin Schulz, Kanzlerkandidat der deutschen SPD
(SPE), kündigte an, ebenso
wie Macron einen offensiv proeuropäischen Wahlkampf führen zu
wollen.
Andere
hingegen gehen bereits jetzt auf Distanz zu Macron – in Deutschland
vor
allem Politiker der CDU/CSU (EVP), aber auch der FDP (ALDE). Und
selbst aus der Europäischen Kommission ist nicht nur Freude über
die Ideen des neuen französischen Präsidenten zu hören:
Jean-Claude Juncker (CSV/EVP) etwa wandte sich zuletzt gegen
Macrons Vorschlag transnationaler Listen, die zwar im Prinzip
eine gute Sache seien, aber „die Bürger nicht interessieren“
würden und deshalb bis auf Weiteres zurückgestellt werden sollten.
Und der christdemokratische Fraktionschef im Europäischen Parlament,
Manfred Weber (CSU/EVP), argumentierte, Macron müsse
erst einmal seine nationalen „Hausaufgaben“ machen und den
französischen Haushalt sanieren, bevor er eine Reform der EU fordern
dürfe.
Weltoffenheit
kann als Wahlkampfstrategie erfolgreich sein
Ob
Emmanuel Macron mit seiner europäischen Agenda erfolgreich sein
wird, können erst die nächsten Jahre zeigen. Die Widerstände, das
ist schon heute klar, werden erheblich sein – aber zugleich bietet
sich ihm auch die Chance, durch seine dezidiert europafreundliche
Rhetorik zur parteiübergreifenden Leitfigur all jener zu werden, die
die Integrationspolitik des Europäischen Rates in den vergangenen
Jahren zu zaghaft und unentschlossen fanden.
Sein
Wahlsieg aber sollte auch für die etablierten Parteien ein Zeichen
dafür sein, dass Halbherzigkeit und schrittweises Nachgeben nicht
die beste Art ist, um auf den Aufstieg der Nationalpopulisten zu
reagieren. Der Konflikt zwischen Kosmopoliten und Souveränisten ist
eine gesellschaftliche Realität. In diesem Konflikt eine klare
Position für Weltoffenheit und Supranationalismus zu beziehen und
diese mit mutigen, zukunftsweisenden Vorschlägen zu unterfüttern,
kann auch als Wahlkampfstrategie erfolgreich sein.
Bild: OECD / Julien Daniel [CC BY-NC-ND 2.0], via Flickr.
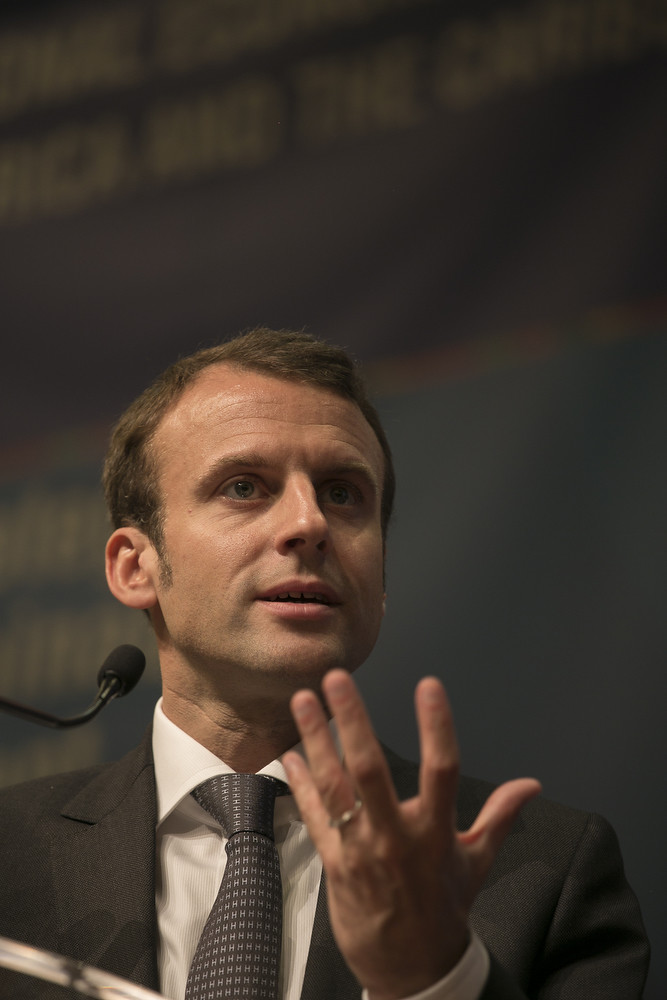
Bedauerlich, dass es zureit keine wahrhaften linken, kosmopolitischen Ikonen bezüglich der EU-Politik gibt!
AntwortenLöschen